Vorhersagbarkeit der
Eigenschaften von Rhätaquiferen in Norddeutschland für die geothermische
Nutzung: Experimentelle Simulation der Anhydritauflösung und -ausfällung
Kurzinformation über laufende Arbeiten (Stand 23.06.2002)
Einleitung
Die Arbeiten, die seit Ende Februar 2002 durchgeführt wurden und über die hier in Kurzform berichtet wird, hatten zum Ziel, die Ausfällung des Anhydrits in geometrisch definierten Räumen, hier Kapillaren, zu untersuchen und das anisotrope Wachstums des Anhydrits im Bentheimer Sandstein zu modellieren.
Ausfällungsmodellierung
Bei den computertomographischen Untersuchungen zur Fällung des Anhydrits im Porenraum wurden eine große Anzahl zementierter Bereiche mit mittleren Durchmessern von 1 bis 2 mm beobachtet. Die Form dieser Bereiche zeigte eine deutliche Asymmetrie. Die Hauptachsen waren in der Regel normal zur Hauptfließrichtung orientiert.
Um einen Anhaltspunkt dafür zu erlangen, ob dieser Effekt der Anisotropie des Kernmaterials und/oder hydrodynamischen Effekten zuzuschreiben ist, wurde der Zementationsprozess im Sinne einer Sensitivitäts-Studie modelliert.
Das 3-D-Modell umfasst die Lösung der Fließ- und der Stofftransportgleichung. Für das Verfüllen des Porenraums wurde eine Reaktionsgleichung erster Ordnung in Bezug auf die CaSO4-Konzentration angesetzt.
Der Befund, dass der Porenraum nicht gleichmäßig mit Anhydrit aufgefüllt wird, sondern jeweils kleine Bereiche mit hoher Zementation und somit geringer Restporosität angetroffen werden, bedeutet, dass die Zementation an wenigen Orten beginnt und der Porenraum ausgehend von diesen Zentren mit Anhydrit aufgefüllt wird.
Deshalb wurde in dem Modell ein Zementationsprozess angesetzt, der von einem einzelnen Keim ausgeht. Um einen Bezug zwischen der ausgefallenen Anhydrit-Masse und der Oberfläche, die in die Reaktionsgleichung eingeht, herstellen zu können, wurde aus REM-Aufnahmen ein Formfaktor abgeleitet. Somit kann die Wachstumsgeschwindigkeit unter der Annahme beschrieben werden, dass die Anhydrit-Oberfläche zugänglich bleibt und kein polykristallines Wachstum herrscht. Für die richtungsabhängigen Permeabilitäten ki und den effektiven Diffusionskoeffizienten Di wurden jeweils sehr einfache Korrelationsgleichungen verwendet:
![]()
![]()
Da das Wachstum in einem einzelnen Bereich bearbeitet wurde, konnte die Modellierung aus Symmetriegründen auf ein ¼ -Segment beschränkt werden. In der Regel wurden ein Gitter mit einer Anzahl von > 8000 Blöcken verwendet.
Im Bewußtsein, dass sich lokale Prozesse bei einer blockweisen Verwendung der phänomenologischen Größen ki und Di wegen der lokalen Anisotropie einer exakten Beschreibung entziehen und letztlich nur eine Information über ein großes Kollektiv erhalten werden kann, wurde kleinen, 110 m m großen Blöcken mittlere, richtungsabhängige Eigenschaften zugeordnet.
Das System neigt im Fall der lokalen Annäherung an die Gleichgewichtskonzentration in Folge der gekoppelten Reaktionsgleichung stark zur Oszillation. Somit müssten nicht akzeptabel kleine Zeitintervalle gewählt werden.
Deshalb wurde hier ein anderer Weg gewählt, der die Probleme, die sich aus der üblichen Linearisierung ergeben, vermeidet:
Da sich die Konzentrationen im jeweiligen Block und in den benachbarten Blöcken in dem betrachteten Zeitintervall nur vernachlässigbar gering ändern und somit die Konzentrationsgradienten unverändert bleiben, kann der Stofftransport innerhalb des Intervalls als quasistationär betrachtet werden. Deshalb ist es vorteilhaft, die Konzentrationsänderung im Block und das Wachstum des Anhydrits im gegebenen Zeitintervall in einfacher Weise durch eine Integration nach Runge-Kutta zu berechnen.
Die verwendeten Basis-Parameter orientierten sich am Experiment:
maximale Zeit: tmax = 1× 106 s
Permeabilität: ko = 2 × 10-12 m2
Porosität: F = 0,23
Restporosität: F o = 0,05
effektiver Diffusionskoeffizient: Do = 5 × 10-10 m2× s-1
effektive, mittlere Geschwindigkeit:
![]() = 5 × 10-7 - 4 ×
10-6 m × s-1
= 5 × 10-7 - 4 ×
10-6 m × s-1
CaSO4-Konzentration im injizierten Fluid: cinj = 20 mol × m-3
CaSO4-Gleichgewichtskonzentration: cgl = 13 mol × m-3
Geschwindigkeitskonstante: kw = 2 × 10-7 m × s-1
Die Geschwindigkeitskonstante für das Wachstum wurde so gewählt, dass bei tmax ein mittlerer Durchmesser des zementierten Bereiches von etwa 1 mm erreicht wurde.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Zusammenwirken des konvektiven und diffusiven Transportes die Form der zementierten Bereiche bestimmt. In dem untersuchten Geschwindigkeitsbereich herrscht ein deutlicher Konzentrationsunterschied zwischen der Vorderseite und der Rückseite der mit CaSO4 verfüllten Region. Deshalb wird auf der gesamten Vorderseite ein erhöhtes Wachstum entgegen der Hauptfließrichtung gefunden. Die Wachstumsgeschwindigkeit normal zur Fließrichtung entspricht der an der Vorderseite. Es wird ein auf der Vorderseite abgeflachter Körper erzeugt, dessen längste Achse normal zur Fließrichtung orientiert ist. Das Achsenverhältnis beträgt nach 106 s ca. 1,2 und ist damit niedriger als erwartet.
Anisotropien der Permeabilität bzw. des effektiven Diffusionskoeffizienten haben überraschenderweise nur geringe Auswirkungen zur Folge. Deshalb ist geplant, die richtungsabhängige Wachstumsgeschwindigkeit, die sich aus der Orientrierung der Anhydritkristallite ergeben kann, in die Untersuchungen einzubeziehen.
Ausfällung in Kapillaren
Da die berechtigte Vermutung bestand, dass der Keimbildungs- und/oder der Wachstumsprozess im starken Maß von der Größe des zur Verfügung stehenden Raums beeinflusst wird, wurden Ausfällungsversuche in Glas- bzw. Quarz-Kapillaren mit Innendurchmesser von 3000 bis 200 mm unternommen. Bei den Versuchen im Millimeterbereich stand eine beheizte Länge von 0,8 m, für die 500 mm und 220 mm -Quarzkapillarsäulen eine Länge von 10 m zur Verfügung.
Das Schema des experimentellen Aufbaus ist in der Abbildung 1 dargestellt.
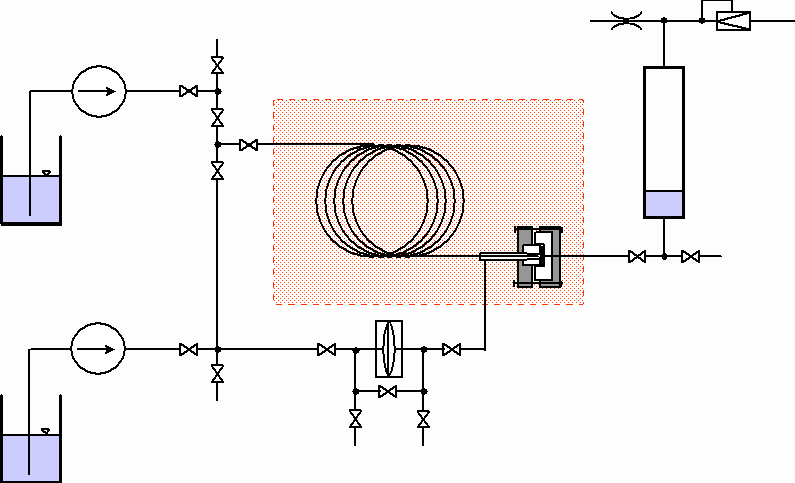
Abb. 1: Schema des Versuchsaufbaues
Die Kapillare befindet sich in einem
Umwälzthermostaten (Trockenschrank). Der Fluss wird durch Labotron-Pumpen
erzeugt. Die Ventilkonfiguration trägt dafür Sorge, dass ein Umschalten von der
Spüllösung, hier ein NaCl-Lösung mit einer Konzentration von
220 g/L, auf eine CaSO4-Lösung ohne zeitliche Verzögerung durch
Totvolumina möglich ist.
Die CaSO4-Lösung wurde auf folgendem Wege dargestellt;
- Sättigung einer NaCl-Lösung (220 g/L) mit Gips bei Raumtemperatur
- Filtration der Lösung
- 17 %-ige Verdünnung mit NaCl-Lösung (220 g/L)
Damit wird eine frühzeitige Ausfällung von Gips oder Anhydrit verhindert.
Um auch bei einer erhöhten Temperatur von 120 °C experimentieren zu können, werden die Fluide am Ausgang in einem mit einem konstanten Gasdruck (0,3 MPa) beaufschlagten Gefäß aufgefangen.
Ein der Säule nachgeschaltetes Membranfilter, das sich in der beheizten Zone befindet, dient dazu Anhydritkeime bzw. kleine Kristallite abzufangen. Andernfalls können wie Versuche zeigten, am Ausgang Blockaden durch ausgefallenes Anhydrit auftreten, da hier Totvolumina mit größeren Verweilzeiten unvermeidlich sind. Der Membranhalter und die Filtratleitung wurden aus Teflon gefertigt, um ein Haften von Kristalliten zu reduzieren. Zu erwähnen ist, das die Standzeiten, der verwendeten Filter unter diesen harschen Bedingungen nur sehr begrenzt sind, so dass keine sicheren Ergebnisse zum Filtrationsprozess erhalten werden konnten.
Der Differenzdruck über der durchflossenen Kapillare wird mit einem kapazitiven Differenzdruckaufnehmer erfasst.
Die Versuche mit Kapillaren wurden in der Regel bis zu einer fast vollständigen Blockade durchgeführt.
Vorherige Versuche, die im Geschwindigkeitsbereich von 8× 10-5 - 4× 10-4 m× s-1 mit Glasrohren mit Innendurchmessern von 3 mm und 4mm durchgeführt wurden, hatten Hinweise dafür gegeben, dass der Ausfällungsprozess durch die Strömungs-geschwindigkeit beeinflußt wird. Bei den niedrigsten Geschwindigkeiten wurde sogar Nadelwachstum beobachtet. Bei höheren Geschwindigkeiten wurden die ersten ausgefallenen Anhydrit-Kristalle erst zu einem späterem Zeitpunkt beobachtet.
Ausgehend von dieser Beobachtung wurden in
der 500 mm -
Quarz-Kapillarsäule Versuche im Bereich hoher Schergeschwindigkeit durchgeführt
mit dem Ziel, die Frage zu beantworten, ob Anhydritkeime durch das strömende
Fluid vollständig ausgeschwemmt werden können und damit eine Ausfällung in der
Säule verhindert wird. Deshalb wurden für die Fällungsversuche hohe mittlere
Geschwindigkeiten von
1,4× 10-3 - 1,1× 10-2 m× s-1 gewählt. Diese
Werte entsprechen Wandschergeschwindigkeiten von 22 - 181 s-1. Die
Fluid-Verweilzeiten in der Kapillarsäule betrugen 0,25 - 2 h. Unter diesen
Bedingungen werden in Abhängigkeit von der Fließrate rechnerisch Strecken von
0,1 - 0,9 m im beheizten Raum benötigt, um eine Aufheizung der Lösung auf eine
Resttemperaturdifferenz zwischen Fluid und Luftbad von
DT = 1 K zu erreichen.
In allen Fällen wurde nach einer Zeit von 30 - 80 h eine Blockade der Säule durch ausgefallenes Anhydrit beobachtet. Die Kristalle in der Säule waren so groß, dass sie ohne eine Vergrößerung erkannt werden konnten.
Der Druckabfall über der Säule bleibt nach dem Beginn der Injektion der CaSO4-haltigen Lösung über lange Zeit (> 20 h) konstant. Der spät einsetzende Anstieg des Druckabfalles infolge der Anhydritausfällung hat bis zu einem Druckabfall von 370 mbar einen annähernd exponentiellen Verlauf. Anschließend führt der schnelle Druckanstieg zur Abschaltung bei 4 bar.
Die Zeiten bis zur Abschaltung streuen
sehr stark. Es ist keine Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit zu
erkennen. Das Mittel über die Zeiten bis zur Blockade beträgt 55 ± 20 h. Es
ergibt sich aber ein deutlicher Trend für eine Abhängigkeit der bis zur
Abschaltung durch die Säule geströmten, normierten Menge V/Vs von der
Geschwindigkeit ![]() :
:
V/Vs = 23 + 1,3× 104
![]() r = 0,83
r = 0,83
mit V = injiziertes Fluidvolumen, Vs = Kapillarsäulenvolumen (1,96 cm3)
Nach dem Versuch sind in der Regel größere Mengen von Kristallen nach einer Strecke von ca. 1 m in der beheizten Zone zu finden. Es sind aber auch über die ganze Säule verteilte, kleine Kristalle mit einer Erstreckung von 0,1 - 0,2 mm zu beobachten. In einem Fall wurde die in der Säule ausgefallenen CaSO4-Menge nach dem Versuch bestimmt. Der gefundene Wert von 174 mg entspricht bei vollständiger Verfüllung einer Kapillarsäulenstrecke von 30 cm, angesichts der Gesamtlänge von 10m ein kleiner Wert.
Aus den Experimenten sind folgende, vorläufige Schlüsse zu ziehen:
Selbst hohe Scherraten können ein Anhaften der Keime/Kristallite an der Quarz-Wandung nicht verhindern. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Keime, die zu visuell beobachtbaren Kristallen (> 50 mm) führen, ist gering (geschätzt < 105). Die statistisch geprägte Keimbildung ist für die große Streuung der Ergebnisse verantwortlich. Die Zeit bis zur Blockade ist von der Wachstumsgeschwindigkeit der Anhydritkristalle geprägt.
Die Blockade fand erwartungsgemäß im vorderen Teil der Säule statt, da Wachstum in diesem Bereich weiteres Wachstum im hinterem Bereich aufgrund der Konzentrationserniedrigung behindert. Es ist zu erwähnen, daß bei allen Versuchen im vorderen Bereich der Säule ein deutlicher CaSO4-Überschuß in Lösung für das Kristallwachstum zur Verfügung stand. Dieses gilt auch für die Versuche bei niedriger Geschwindigkeit.
.