Numerische Modellierung
Ansprechpartner
| RWTH
Aachen |
LUNG
Mecklenburg-VP |
TU
Hamburg-Harburg |
TU
Clausthal |
| C.
Clauser |
J.
Iffland |
M.
Kühn |
I.
Leiczak |
| H.
Pape |
GTN
Neubrandenburg |
W.
Schneider |
V.
Meyn |
| R.Wagner |
J.
Bartels |
|
|
| |
|
|
|
Veränderungen der Reservoireigenschaften durch
den Langzeitbetrieb hydrogeothermaler Anlagen: Simulation und Experiment
Das Simulationsprogramm SHEMAT ist ein neu entwickeltes numerisches
Simulationswerkzeug zur Berechnung komplexer, stationärer und
transienter Prozesse in hydrogeothermalen Reservoirs. Es ist im Rahmen
eines Verbundforschungsvorhabens entwickelt worden, um Langzeitprognosen
der Speichereigenschaften bei der geothermischen Energiegewinnung
aufstellen zu können. Es stellt aber auch ein allgemeines einsetzbares
Werkzeug dar, um eine große Bandbreite von Prozessen und Problemen
in Sedimentspeichern sowohl in technischen als auch geologischen Zeiträumen
zu untersuchen. Strömung, Wärmetransport, Ionentransport
und heterogene Chemie sind wechselseitig gekoppelt. Der Wärmetransport
ist nichtlinear aufgrund der Temperaturabhängigkeit der Wassereigenschaften
und der Gesteinswärmeleitfähigkeit. Durch Kopplung der Fluiddichte
an die Temperatur und den Salzgehalt ist das Modell in der Lage, dichtegetriebene
Konvektion zu berücksichtigen. Fällung- und Lösungsumsätze
der Minerale werden innerhalb des Modells durch eine erweiterte Version
des geochemischen Modells PHRQPITZ bereitgestellt. Es ermöglicht die
Berechnung der geochemischen Reaktionen in Speicherfluiden von niedriger
Salinität bis hin zur Sättigungsgrenze und bei Temperaturen
von 0 - 150 °C. Die Parameter der von Temperatur and Übersättigung
abhängigen Reaktionskinetik können von außen über die im
Projekt entwickelte graphische Benutzeroberfläche "Processing
Shemat" an die jeweils neuesten experimentellen Befunde angepasst
und erweitert werden.
| |
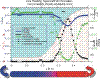 |
|
Abb.1:
Lösung, Transport und Wiederausfällung von Anhydrit in einem
gefluteten Sandstein-Kern mit Temperatur-
gradient (80-100 °C).
Das Experiment von Meyn und Lajcsak (1999) wurde mit SHEMAT nachmodelliert.
Dabei wurde für den Zusammenhang zwischen Permeabilität k
und Porosität f eine Potenzfunktion mit dem Exponenten 12
verwendet. |
| |
Chemische Wasser - Gesteins - Wechselwirkung modifiziert die Porenraumstruktur.
Das wiederum verändert die Transport- und Fördereigenschaften
des Reservoirs. Diesem Rückkopplungsmechanismus wird im Modell dadurch
Rechnung getragen, dass ständig die Permeabilitätsänderung
aus der Porositätsveränderung berechnet wird, die aus der
Mineralfällung und -lösung resultiert. Das erfolgt über eine
dreigliedrige Potenzreihe bezüglich der Porosität in der gebrochene,
d.h. eine fraktale Geometrie repräsentierende Exponenten auftreten
können. Diese neue Beziehung wurde aus einem selbstähnlichen
und fraktalen Strukturmodell des Porenraumes und seiner Veränderungen
hergeleitet und experimentell verifiziert.
Mit SHEMAT wurde erfolgreich die räumliche Verteilung der Permeabilitätsveränderung
simuliert, die in einem Kerndurchströmungsexperiment unter Speicherbedingungen
gemessen wurde. Ursache der Permeabilitätsänderung war dabei
die Umlösung von Anhydrit in einem von außen aufgeprägten
durchströmten Temperaturgradienten. Dadurch wurde die Situation
an der Kaltwasserfront einer geothermischen Doubletteninstallation
experimentell nachgebildet. Zu den bereits simulierten Szenarien gehören
die hochaufgelöste Umgebung der Reinjektionsbohrung für die abgekühlte
Thermalsole und die Langzeitsimulation einer geothermische Doublettenanordnung
zur Wärmegewinnung bei NaCl-Gehalten an der Sättigungsgrenze.
(Publication at the World
Geothermal Congress 2000, Kyushu-Tohoku, Japan)